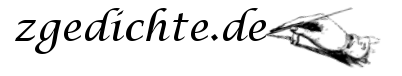I.
Silvesterfei
Der morsche Tag ist eingesunken;
Sein Auge gläsern, kalt und leer,
Barg keines Taues linden Funken
Für den gebräunten Eppich mehr.
Wie′s draußen schauert! — längs der Wand
Ruschelt das Mäuslein unterm Halme,
Und langsam sprießt des Eises Palme
Am Scheibenrand.
In tiefer Nacht wem soll noch frommen
Am Sinne dort der Lampe Strahl?
Da schon des Herdes Scheit verglommen,
Welch späten Gastes harrt das Mahl?
Längst hat im Turme zu Escout
Die Glocke zwölfmal angeschlagen,
Und glitzernd sinkt der Himmelswagen
Dem Pole zu.
Durch jener Kammer dürre Barren
Ziehn Odemzüge, traumbeschwert,
Ein Ruck mitunter auch, ein Knarren,
Wenn sich im Bett der Schläfer kehrt;
Und nur ein leiser Husten wacht,
Kein Traum die Mutter hält befangen,
Sie kann nicht schlafen in der langen
Silvesternacht.
Jetzt ist die Zeit, wo los′ und schleichend
Die Fei sich durch die Ritze schlingt,
Mit langer Schlepp′ den Estrich streichend
Das Schicksal in die Häuser bringt,
An ihrer Hand das Glück, Gewind′
Und Ros′ im Lockenhaar, ein schlankes, —
Das Mißgeschick ein fieberkrankes,
Ein weinend Kind.
Und trifft sie alles recht zu Danke
Geordnet von der Frauen Hand,
Dann nippt vom Mahle wohl die schlanke
Und läßt auch wohl ein heimlich Pfand;
Doch sollt′ ein Frevler lauschen, risch,
Im Hui, zerstoben ist die Szene,
Und scheidend fällt des Unglücks Träne
Auf Herd und Tisch.
O keine Bearnerin wird′s wagen
Zu stehn am Astloch; lieber wird
Ein Tuch sie um die Augen schlagen,
Wenn durch den Spalt die Lampe flirrt.
Manon auch drückt die Wimper zu
Und zupft an der Gardinen Linnen;
Doch immer, immer läßt das Sinnen
Ihr keine Ruh′.
Ward glatt das Leilach auch gebreitet?
Hat hell der Becher auch geblinkt?
Ob jetzt das Glück zum Tische gleitet,
Ein Bröcklein nascht, ein Tröpflein trinkt?
Oft glaubt sie zarter Stimmen Hauch,
Verschämtes Trippeln oft zu hören,
Und dann am Brote leises Stören
Und Knuspern auch.
Sie horcht und horcht — das war ein Schlüpfen!
Doch nein — der Wind die Föhren schwellt,
Und das — am Flur ein schwaches Hüpfen,
Wie wenn zum Grund die Krume fällt!
»Eugène, was wirfst du dich umher,
Was soll denn das Gedehn′ und Ziehen?
Mein Gott, wie ihm die Händchen glühen!
Er träumt so schwer.«
Sie rückt das Kind an ihrer Seiten,
Den Knaben, dicht zu sich heran,
Läßt durch sein Haar die Finger gleiten,
Es hangen Schweißes Tropfen dran;
Erschrocken öffnet sie das Aug′,
Will nach dem Fensterglase schauen,
Da eben steigt das Morgengrauen,
Ein trüber Rauch.
Vom Lager fährt die Mutter, bebend
Hat sie der Lampe Docht geheilt,
Als sachte überm Leilach schwebend
Ein Efeublatt zu Boden fällt.
Das Glück! das ist des Glückes Spur!
Doch nein! — sie pfückt′ es ja dem Kinde,
Und dort — nascht′ an der Semmelrinde
Die Ratte nur.
Und wieder aus der Kammer stehlen
Sich Seufzer, halbbewußt Gestöhn;
»O Christ, was mag dem Knaben fehlen,
Eugène, wach auf, wach auf, Eugène!
Du lieber Gott, ist so geschwind,
Eh noch der Morgenstrahl entglommen,
Das Unglück mir ins Haus gekommen
Als krankes Kind!«
II.
Münzkraut
Der Frühling naht, es streicht der Star
Am Söller um sein altes Nest;
Schon sind die Täler sonnenklar,
Doch noch die Scholle hart und fest;
Nur wo der Strahl vom Felsen prallt,
Will mählich sich der Grund erweichen
Und schüchtern aus den Windeln schleichen
Der Gräser dichter lichter Wald.
Schau dort am Riff — man sieht es kaum —
So recht vom Sonnenbrand gekocht
Das kleine Beet, vier Schritte Raum,
Vom Schieferhange überjocht,
Nach Ost und Westen eingehegt,
Mit starken Planken abgeschlagen,
Als sollt′ es Wunderblumen tragen,
Und sind nur Kräuter, was es trägt.
Und dort die Frau an Riffes Mitten,
Ach Gott, sie hat wohl viel gelitten!
Sie klimmt so schwer den Steig hinan,
Nun steht sie keuchend, löst das Mieder,
Nun sinkt sie an dem Beete nieder
Und faltet ihre Hände dann:
»Liebe Münze, du werter Stab,
Drauf meines Heilands Sohle stand,
Als ihm drüben im Morgenland
Sankt Battista die Taufe gab;
Heiliges Kraut, das aus seinem Leibe
Ward gesegnet mit Wunderkraft,
Hilf einer Witw′, einem armen Weibe,
Das so sorglich um dich geschafft!
»Hier ist Brot, und hier ist Salz und Wein,
Sieh, ich leg′s in deine Blätter mitten;
Woll′ nicht zürnen, daß das Stück so klein,
Hab′s von meinem Teile abgeschnitten;
Etwas wahrt′ ich, Münze gnadenreich,
Schaffens halber nur, sonst gäb ich′s gleich.
»Mein Knab′ ist krank, du weißt es wohl,
Ich kam ja schon zu sieben Malen,
Und gestern mußt′ ich in Bregnoles
Den Trank für ihn so teuer zahlen.
Vier hab′ ich, vier, daß Gott erbarm′!
Mit diesen Händen zu ernähren,
Und, sieh, so kann′s nicht länger währen,
Denn täglich schwächer wird mein Arm.
»O Madonna, Madonna, meine gnädige Frau!
Ich hab′ gefrevelt, nimm′s nicht genau,
Ich hab′ gesündigt wider Willen!
Nimm, o nimm mir nur kein Kind,
Will ihm gern den Hunger stillen,
Wär′s mit Bettelbrot; nicht eins
Kann ich missen, von allen keins!
»Zweimal muß ich noch den Steig hinan,
Siebenmal bin ich nun hier gewesen.
Heil′ge Frau von Embrun, wär′ dann
Welk die Münze und mein Knab′ genesen,
Gerne will ich dann an deinem Schrein
Meinen Treuring opfern, er ist klein,
»Nur von Silber, aber fleckenrein;
Denn ich hab′ mit Ehren ihn getragen,
Darf vor Gott und Menschen mich nicht schämen;
Milde Fraue, laß mich nicht verzagen,
Liebe Dame, woll′ ihn gütig nehmen,
Denk, er sei von Golde und Rubin,
Süße, heil′ge, werte Himmelskönigin!«
III.
Der Loup Garou
Brüderchen schläft, ihr Kinder, still!
Setzt euch ordentlich her zum Feuer!
Hört ihr der Eule wüst Geschrill?
Hu! im Walde ist′s nicht geheuer;
Frommen Kindern geschieht kein Leid,
Drückt nur immer die Lippen zu!
Denn das böse, das lacht und schreit,
Holt die Eul′ und der Loup Garou.
Wißt ihr, dort, wo das Naß vom Schiefer träuft
Und überm Weg ′ne andre Straße läuft,
Das nennt man Kreuzweg, und da geht er um
Bald so, bald so, doch immer falsch und stumm
Und immer schielend; vor dem Auge steht
Das Weiße ihm, so hat er es verdreht.
Dran ist er kenntlich und am Kettenschleifen,
So trabt er, trabt, darf keinem Frommen nahn,
Die schlimmen Leute nur, die darf er greifen
Mit seinem langen, langen, langen Zahn. —
Schiebt das Reisig der Flamme ein,
Puh, wie die Funken knistern und stäuben!
Pierrot, was soll das Wackeln sein?
Mußt ein Weilchen du ruhig bleiben,
Gleich wird die Zeit dir jahrelang!
Laß doch den armen Hund in Ruh′!
Immer sind deine Händ′ im Gang,
Denkst du denn nicht an den Loup Garou?
Vom reichen Kaufmann hab′ ich euch erzählt,
Der seine dürft′gen Schuldner so gequält,
Und kam mit sieben Säcken von Bagnères,
Vier von Juwelen, drei von Golde schwer;
Wie er aus Geiz den schlimmen Führer nahm
Und ihm das Untier auf den Nacken kam.
Am Halse sah man noch der Kralle Spuren,
Die sieben Säcke hat es weggezuckt,
Und seine Börse auch, und seine Uhren,
Die hat es all zerbissen und verschluckt. —
Schließt die Tür, es brummt im Wald!
Als die Sonne sich heut verkrochen,
Lag das Wetter am Riff geballt,
Und nun hört man′s sieden und kochen.
Ruhig, ruhig, du kleines Ding!
Hörst du? drunten im Stalle — hu!
Hörst du? Hörst du′s? kling, klang, kling,
Schüttelt die Kette der Loup Garou.
Doch von dem Trunkenbolde wißt ihr nicht,
Dem in der kalten Weihnacht am Gesicht
Das Tier gefressen, daß am heilgen Tag
Er wund und scheußlich überm Schneee lag.
Zog von der Schenke aus, in jeder Hand
′ne Flasche, die man auch noch beide fand.
Doch wo die Wangen sonst, da waren Knochen,
Und wo die Augen, blut′ge Höhlen nur;
Und wo der Schädel hier und da zerbrochen,
Da sah man deutlich auch der Zähne Spur.
Wie am Giebel es knarrt und kracht!
Caton, schau auf die Bühne droben —
Aber nimm mir die Lamp′ in acht! —
Ob vor die Luke der Riegel geschoben.
Pierrot, Schlingel, das rutscht herab
Von der Bank, ohne Strümpf′ und Schuh!
Willst du bleiben! Tapp, tipp, tapp,
Geht auf dem Söller der Loup Garou.
Und meine Mutter hat mir oft gesagt
Von einem tauben Manne, hochbetagt,
Fast hundertjährig, dem es noch geschehn
Als Kind, daß er das Scheuel hat gesehn,
Recht wie ′nen Hund, nur weiß wie Schnee und ganz
Verkehrt die Augen, eingeklemmt den Schwanz,
Und spannenlang die Zunge aus dem Schlunde;
So mit der Kette weg an Waldes Bord,
Dann wieder sah er ihn im Tobelgrunde,
Und wieder sah er hin — da war er fort.
Hab′ ich es nicht gedacht? Es schneit!
Ho, wie fliegen die Flocken am Fenster!
Heilige Frau von Embrun! wer heut
Draußen wandelt, braucht keine Gespenster;
Irrlicht ist ihm die Nebelsäul′,
Führt ihn schwankend dem Abgrunde zu,
Sturmes Flügel die Toteneul′,
Und der Tobel sein Loup Garou.
IV.
Maisegen
Der Mai ist eingezogen,
Schon pflanzt er sein Panier
Am dunklen Himmelsbogen
Mit blanker Sterne Zier.
Die wilden Wasser brausen
Und rütteln aus den Klausen
Rellmaus und Murmeltier.
»Ob wohl das Gletschereis den Strom gedämmt?
Von mancher Hütte geht′s auf schlimmen Wegen,
Der Sturm hat alle Firnen kahl gekämmt,
Und gestern wie aus Röhren schoß der Regen,
Adieu, Jeannette, nicht länger mich gehemmt!
Adieu, ich muß, es gilt den Maiensegen;
Wenn Vier es schlägt im Turme zu Escout,
Muß jeder Senner stehn am Pointe de Droux.«
Wie trunken schaun die Klippen,
Wie taumelnd in die Schlucht!
Als nickten sie, zu nippen
Vom Sturzbach auf der Flucht.
Da ist ein rasselnd Klingen,
Man hört die Schollen springen
Und brechen an der Bucht.
Auf allen Wegen ziehn Laternen um,
Und jedes Passes Echo wecken Schritte.
Habt acht, habt acht, die Nacht ist blind und stumm,
Die Schneeflut fraß an manches Blockes Kitte;
Habt acht, hört ihr des Bären tief Gebrumm?
Dort ist sein Lager an des Riffes Mitte;
Und dort die schiefe Klippenbank, fürwahr!
Sie hing schon los am ersten Februar.
Nun sprießen blasse Rosen
Am Gletscherbord hervor,
Und mit der Dämmrung kosen
Will schon das Klippentor;
Schon schwimmen lichte Streifen,
Es lockt der Gemse Pfeifen
Den Blick zum Grat empor.
Verlöscht sind die Laternen, und im Kreis
Steht eine Hirtenschar auf breiter Platte,
Voran der Patriarch, wie Silber weiß
Hängt um sein tiefgebräunt Gesicht das glatte,
Gestrählte Haar, und alle beten leis,
Nach Osten schauend, wo das farbensatte
Rubingewölk mit glitzerndem Geroll
Die stolze Sonnenkugel bringen soll.
Da kommt sie aufgefahren,
In strenger Majestät,
Und von den Firnaltaren
Die Opferflamme weht:
Da sinken in der Runde
So Knie an Knie, dem Munde
Entströmt das Maigebet:
»Herr Gott, der an des Maien erstem Tag
Den Strahl begabt mit sonderlichem Segen,
Den sich der sünd′ge Mensch gewinnen mag
In der geweihten Stunde, allerwegen,
Segne die Alm, segne das Vieh im Hag
Mit Luft und Wasser, Sonnenschein und Regen,
Durch Sankt Anton den Siedel, Sankt Renee,
Martin von Tours und unsre Frau vom Schnee.
»Segne das Haus, das Mahl auf unserm Tisch,
Am Berg den Weinstock und die Frucht im Tale,
Segne die Jagd am Gletscher und den Fisch
Im See und das Getiere allzumale,
So uns zur Nahrung dient, und das Gebüsch,
So uns erwärmt, mit Tau und Sonnenstrahle,
Durch Sankt Anton, den Siedel, Sankt Remy,
Sankt Paul und unsre Fraue von Clery.
»Wir schwören« — alle Hände stehn zugleich
Empor — »wir schwören, keinen Gast zu lassen
Von unserm Herd, eh sicher Weg und Steig,
Das Vieh zu schonen, keinen Feind zu hassen,
Den Quell zu ehren, Recht an arm und reich
Zu tun und mit der Treue nicht zu spaßen.
Das schwören wir beim Kreuze zu Autun
Und unsrer mächt′gen Fraue von Embrun.«
Da überm Kreise schweben,
Als wollten sie den Schwur
Zum Himmelstore heben,
Zwei Adler; auf die Flur
Senkt sich der Strahl vom Hange,
Und eine Demantschlange
Blitzt drunten der Adour.
Die Weiden sind verteilt, und wieder schallt
In jedem Passe schwerer Tritte Stampfen.
Voran, voran! die Firnenluft ist kalt
Und scheint die Lunge eisig zu umkrampfen.
Nur frisch voran — schon sehn sie überm Wald
Den Vogel ziehn, die Nebelsäule dampfen,
Und wo das Riff durchbricht ein Klippengang,
Summt etwas auf, wie ferner Glockenklang.
Da liegt das schleierlose
Gewäld in Sonnenruh,
Und wie mit Sturmgetose
Dem Äthermeere zu,
Erfüllt des Tales Breite
Das Angelusgeläute
Vom Turme zu Escout.
V.
Höhlenfei
Siehst du drüben, am hohlen Baum,
Ins Geklüfte die Schatten steigen,
Überm Bord, ein blanker Saum,
Leises Quellengeriesel neigen?
Das ist die Eiche von Bagnères,
Das ist die Höhle Trou de fer,
Wo sie tags in der Spalten Raum,
Nächtlich wohnt in den surrenden Zweigen.
O, sie ist überalt, die Fei!
Laut Annalen, vor grauen Jahren,
Zwei Jahrhunderten oder drei,
Mußte sie seltsam sich gebaren:
Bald als Eule mit Uhuhu,
Bald als Katze und schwarze Kuh;
Auch als Wiesel, mit feinem Schrei,
Ist sie über die Kluft gefahren.
Aber, wenn jetzt im Mondenschein
Zarte Lichter den Grund betüpfen,
Sieht mitunter man am Gestein
Sie im schillernden Mantel hüpfen,
Hört ihr Stimmchen, Gesäusel gleich;
Aber nahst du, dann nickt der Zweig,
Und das Wasser wispert darein,
Und du siehst nur die Quelle schlüpfen.
Reich an Gold ist der Höhle Grund,
O wie Guinea und wie Bengalen!
Und man spricht vom bewachenden Hund,
Doch des melden nichts die Annalen;
Aber mancher, der wundersam,
Unbegreiflich zu Gelde kam,
Ließ, so kündet der Sage Mund,
Es am Baum von Bagnères sich zahlen,
Barg einen Beutel im Hohle breit,
Drin den neuen Liard bedächtig,
Recht in der sengenden Mittagszeit,
Die den Geistern wie mitternächtig,
Fand ihn abends mit Gold geschwellt —
O, kein Christ komme so zu Geld!
Falsch war Feiengold jederzeit,
Kurz das Leben, und Gott ist mächtig.
Einmal nur, daß mich des gedenkt,
Ist ein Mann an den Baum gegangen,
Hat seinen Sack hinein gesenkt,
Groß, eines Königs Schatz zu fangen;
′s war ein Wucherer, war ein Filz,
Ein von Tränen geschwellter Pilz,
Nun, er hat sich zuletzt gehenkt —
Besser hätt′ er schon da gehangen!
Hielt die Lippen so fest geklemmt,
— Denn Geflüster nur, mußt du wissen,
Das ist eben, was alles hemmt,
Lieber hätt′ er die Zunge zerbissen; —
Barfuß kam er, auf schlechten Rat,
Und als da in die Scherb′ er trat,
Hat er sich nur an den Baum gestemmt
Und den Schart aus der Wunde gerissen.
Doch als aus dem Gemoder scheu
Schlüpft ′ne Schlange ihm längs den Haaren,
Da ist endlich ein kleiner Schrei,
Nur ein winziger, ihm entfahren;
Und am Abend? — verschwunden war
Großer Sack und neuer Liard.
O, verräterisch ist die Fei!
Und es wachen der Hölle Scharen.
VI.
Johannistau
Es ist die Zeit nun, wo den blauen Tag
Schon leiser weckt der Nachtigallen Schlag,
Wo schon die Taube in der Mittagsglut
Sich trunkner, müder breitet ob der Brut,
Wo abends, wenn das Sonnengold zergangen,
Verlorner Funke irrt, des Wurmes Schein,
An allen Ranken Blütenbüschel hangen,
Und Düfte ziehn in alle Kammern ein.
»Weck mich zur rechten Zeit, mein Kamerad,
Versäumen möcht′ ich Sankt Johannis Bad
Um alles nicht; ich hab′ das ganze Jahr
Darauf gehofft, wenn mir so elend war.
Jérôme, du mochtest immer gut es meinen,
Bist auch, wie ich, nur armer Leute Kind,
Doch hast du klare Augen und die Deinen,
Und ich bin ein Waise und halb blind!
»Hat schon der Hahn gekräht? ich hab′s verfehlt;
Oft schlaf′ ich fest, wenn mich der Schmerz gequält.
Ob schon die Dämmrung steigt? ich seh′ es nicht,
Mir fährt′s wie Spinneweben am Gesicht;
Doch dünkt mich, hör′ im Stalle ich Gebimmel
Und Peitschenknall; was das für Fäden sind,
Die mir am Auge schwimmen? lieber Himmel,
Ich bin nicht halb, ich bin beinah schon blind!
»Hier ist der Steg am Anger, weiter will
Ich mich nicht wagen, hier ist alles still,
Und Tau genug für Kranke allzumal
Des ganzen Weilers, eh der Sonnenstrahl
Mit seinem scharfen Finger ihn gestrichen
Und aufgesogen ihn der Morgenwind;
Doch ist kein Zweiter wohl hierher geschlichen;
Denn, Gott sei Dank, nur wenige sind blind.
»Das ist ein Büschel — nein — doch das ist Gras,
Ich fühle meine Finger kalt und naß;
Johannes, heiliger Prophet, ich kam
In deinem werten Namen her und nahm
Von jenem Taue, den im Wüstenbrande
Die Wolke dir geträufelt, lau und lind,
Daß nicht dein Auge in dem heißen Sande,
Nicht dein gesegnet Auge werde blind.
»Gepredigt hast du in der Steppenglut —
So weißt du auch, wie harte Arbeit tut;
Doch arm und nicht der Arbeit fähig sein,
Das ist gewiß die allergrößte Pein.
Du hast ja kaum geruht in Mutterarmen,
Warst früh ein elternlos, verwaistes Kind,
Woll′ eines armen Knaben dich erbarmen,
Der eine Waise ist, wie du, und blind!«