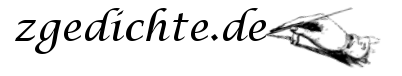Doch nicht immer der Berge melanchol′sche
Wälderschauer, der Felsschlucht altes Dunkel,
Wo des Räubers Auge dem Wandrer lauert,
Und der fliegende Dolch so manchen Busen
Von den Qualen des Lebens schon befreiet,
Doch nicht immer des Bergstroms ödes Brausen
Und des Sturmes Gespielen, jene Wipfel
Uralt rauschender Bäum′ und jene Pfade,
Die nur selten das Maulthier keuchend wandelt,
Wären meine Gesellschaft. Menschen suchen
Gerne Menschen. Erhab′ne Geister freilich,
Schöpferische, die Herrscherthrone stützen,
Völkern, oder den Sternen, des Gedankens
Unergründlichem Werk, ja selbst dem Gotte
Den er denkt, des Gesetzes Ordnung geben,
Die das All und was in ihm ist, bis zu der
Pflanze treibendem Keim, die weite Schöpfung,
Die lebend′ge, mit ihrem Geist, mit Anfang
Selbst und Ende, die Alles, was im Raume,
Alles, was in der Zeit geschieht und lebet,
Zaubrern ähnlich, in Zahl und Chiffern bannen,
Geister auch, die des Bildes ew′ge Schönheit
Aus dem Marmor mit Schöpferfreiheit rufen,
Als ob längst sie vollendet in der rohen
Ird′schen Masse geschlummert, und nun herrlich,
Wie die Seele dem Körper, ihr entstiegen,
Ferne wären sie mir. Doch wie die Sonne,
Der unendliche Lichtquell, alles Lebens
Heitre Mutter, die Schatten auch erzeuget,
Folgt dem Genius auch des Schwarzen, Dunkeln,
Allzuviel, und der karge Neid, die grimme
Eifersucht und der Bosheit Schlangentäuschung,
Alle Martern und Leiden einer kühnen
Ruhmbegierigen thatenlust′gen Seele,
Nie mehr träfen sie mich; treulose Herzen
Und eidbrüchige Freunde würfen nie mehr
Tödtlich Gift in die Quelle, die kastal′sche,
Wo ich schöpf′ und den ernsten Musen opfre;
Haß und Kleinmuth bekränzte mir den Altar,
Wo die Flamm′ ich entzünde, nicht mit Dornen,
Statt mit Rosen und süßer Myrt′ und Lorbeer;
Vor dem Grauen der schicksalsheil′gen Furien
Furchtsam zitternd, verbärg′ ihr süßes Antlitz
Mir die fliehende, scheue Grazie nicht mehr;
Lieblich wäre mein Lied alsdann und lauter
Wie italischer Aether; meines Lebens
Milde sinkende Sonne göss′ in diesen
Sanften Himmel des Liedes ihres Abends
Schönstes, glühendstes Gold; besänftigt ruhte
Nun im friedlichen Glanze meiner Leiden
Endlos Meer, die beschwornen Stürme schwiegen,
Und in Blüten des neuen Frühlings sänge
Nun die Nachtigall. Wenn die Nacht sich nahte,
Stiegen nicht die Gespenster mehr der Todten
Leichenbleich aus den Gräbern; still erschiene
Mir die Sonne der Schlafenden, der Träume
Zücht′ge Göttin; die Stätte, wo sie ruhen,
Die Geliebten, umduftet′ eine Klarheit,
Wie von jenseits zur Erde niederdämmernd.
Mein Begleiter, mein Freund und Umgang aber
Wäre doch nur Homer; denn wie ich ferne
Von der Mitwelt und ihrem Wuste lebte,
Möcht′ ich auch nur der Kinder und der Helden,
Nur der Weisen und Götter Sprache hören!
Einsam wäre ja dann und schlicht und kräftig
Auch mein Leben, so wie mein Lied; am Quelle
Treuer heil′ger Natur säß′ ich, in ihrer
Unerschöpflichen Flut mich täglich badend,
Jeden Flecken vertilgend, und in immer
Voll′rer schön′rer Gesundheit wachsend, säh′ ich
Zur unsterblichen Jugend schon mich reifen;
Ruhig kehrt′ ich in Platon′s Arme wieder,
Ein Enttäuschter, zurück, der ich die Wahrheit
Irrend außer mir sucht′, und, wie sie schweigend
Mir im Busen gewohnt so lang′ nicht wußte.
Freudeschauernd begrüßt′ ich Diotima′s
Seherlehre zum erstenmale wieder,
Von den Schmerzen der Wanderung genesen,
Von der Liebe der Körper und der Seelen,
Von der Sehnsucht der unvollkomm′nen Schönheit.
Die zum Menschen uns lockt, zum ersten Anschau′n
Allvollendeter, geist′ger, ew′ger Schönheit,
Die in Gott ist, die reine Seele wendend.