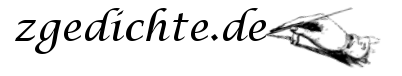Am Tage, da St. Petrus einst in Rom
Den heil′gen Stuhl der Christenheit bestiegen,
Sieht man das Volk in seinem Riesendom
Vorm heil′gen Vater auf den Knieen liegen.
Und wie sie alle gläubig oder nicht
Von allen Enden zu dem Fest erschienen,
Da als der Glocke mächtiges Gewicht
Vom Schlag erklang, so kam auch ich mit ihnen -
Und als die Feier nun vollendet war,
Saß ich noch lange stumm an einer Säule,
Ich dachte manches mir, und wunderbar
Auch die Vergangenheit in stiller Weile.
Wenn hinter deinen stolzen Pinienhain
Die Sonne sinkt in ihren süßen Gluthen,
Gianicolo, wie da im Abendschein
Die Wolken trunken sind von goldnen Fluthen,
Ja, wie das Meer, wenn′s auch die Klipp′ umschäumt,
Die Fläche hin voll immer zärt′rer Töne,
Von dieses Himmels reinem Licht besäumt,
Doch glänzt in unaussprechlich hoher Schöne,
So sanft im Sonnenschein des Augenblicks
Erglühten alle Schatten meines Lebens,
Und selbst dem dunkeln Abgrund des Geschicks
Entdrohten alle Strömungen vergebens.
Dem Tantalus glich einst die Herzensqual,
Die mir die Tage nahm, die Nächte raubte,
Dem alten Halbgott, der das Feuer stahl,
Und das Geschlecht nur zu beglücken glaubte.
Fern vom Lebend′gen, in der Schattenwelt
Stand ich verwaist in grenzenloser Leere,
Die Brust vom heißen Wissensdurst geschwellt,
Von Sehnsucht nach Verdienst und Ruhm und Ehre.
Es winkte mir des Lebens goldne Frucht,
Und doch entschwang der Zweig sich meinen Lippen,
Und mitten in der Fluth war ich verflucht,
In Tropfen nur den kühlen Trunk zu nippen.
Und meine Schuld? Ach daß in kühnerm Drang
Nach höhern Dingen und nach größern Thaten
Mein Mund oft im begeisterten Gesang
Aus dem Olymp Geheimnisse verrathen.
Und als in reichem Frühling mein Gemüth
Die jungen frischen Augen aufgeschlossen,
In ungemeßner Liebe nun erblüht,
Den höchsten Schmerz, die höchste Lust genossen,
Da knüpft′ ich thöricht an der Blüthe Saft
Die sel′ge Hoffnung eines ew′gen Segens,
Bald starb die schöne Wirkung mit der Kraft,
Die Blume mit dem Keim des frohen Regens.
Der Schlange glich ich nun, die halb zerstückt,
Vom blut′gen Schwerdt der Feinde schon zerspalten,
Im letzten ungeheuern Weh umstrickt,
Was sie für alle Ewigkeit will halten.
Doch wie sie aus sich selbst sich auch erneut,
So wuchs auch ich aus eignem Drange wieder,
Nur daß von schwerer Schicksalshand geweiht,
Des Gifts zuviel blieb in der grimmen Hyder. -
Jetzt sah ich mich im großen Gotteshaus
Der Christenheit allein in all′ der Menge,
Sie beteten, sie gingen ein und aus,
Und Tausende verlor ich im Gedränge.
Hat ja ein Volk beinahe Raum genug
In diesem freundlich hochgewölbten Baue,
In dessen Hallen mich die Sehnsucht trug,
In dem ich auf, wie zu den Sternen schaue.
Still ist′s um mich: der ferne Orgellaut
Klingt leise her zu mir aus der Kapelle,
Jemehr der Abend durch den Tempel graut,
Jemehr die Sonne schwindet und die Helle.
Bald schweigt′s, und lange Züge seh′ ich schon
Die weite Marmorebene durchwallen,
Ein heilig Lied in schwermuthsvollem Ton
Hör′ ich in den Gewölben dumpf verhallen.
Sie sind verschwunden mit dem Volksgewühl:
Um mich und über mir ist′s Todtenstille,
Und dieser Stätte schauderndes Gefühl
Ergreift das Herz in nie gekannter Fülle.
Wie′s dunkelt! Wie schon von den Höh′n herab
Die Schatten wandeln in gewalt′gen Massen,
Wie seh′ ich′s düstern um St. Petri Grab,
Wie der Apostel furchtbar Bild erblassen!
Wie lagert sich voll heil′gem Grau′n die Nacht
Schon in der Kuppel wie in ihrem Schooße,
Wie Buonarotti′s Geist in ihr erwacht,
Die über Berge ragt gleich einer Rose.
Mich faßt der Schwindel! Als ob Geister mich
Empor zur himmelweiten Rundung zögen,
Wie für Jahrtausende, so fürchterlich
Thürmt sich hinan die Marmorlast der Bögen.
Welch Pünktchen in der dunkeln Fläche dort!
Kaum sichtbar ist′s - es regt sich - auf den Knieen
Liegt noch ein Mönch - bald schwebt auch dieser fort,
Allein bin ich mit meinen Phantasieen.
Ich blick′ empor, und bin der Mücke gleich,
Wie klein der Lichterkreis das Grab umzittert,
In diesem übermächt′gen Schöpfungsreich
Fühl′ ich vom Weltgeist schaudernd mich umwittert.
Mich fesselt eine namenlose Macht,
So daß die Sinne mir in Nebel schwinden,
Bis sich im Schlummer kühner angefacht,
Des Geistes Flammen, so wie nie entzünden.