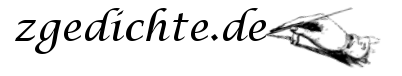Noch bin ich nicht allein, wenn auch mein Herz
Den Menschen längst verlor, den einst so heiß,
So lang geliebten, und vom bunten Kreis
Des Lebens und der Gegenwart zur Nacht
Und Einsamkeit und in den finstern Graus,
Zu Trümmern einer fernen Heldenzeit,
In deine stille wilde Felsenwelt,
Die grünen Haine, die verlaßnen Höhn,
Die lichtbeglänzten, Apeninn, entfloh;
O dennoch bin ich nicht allein, noch blieb
Mir Eine Freundin nach so trüber Zeit
Von Allen, Allen, die ich einst geliebt,
Die einz′ge noch, die Treue mir bewahrt.
Ach nur mit heißen Thränen, mit dem Schmerz,
Der letzten Liebe, Freundin, nenn′ ich dich,
Erhab′ne, die dem Stammelnden ja schon
Dein hoch uranisch Angesicht gezeigt,
Dem Schüchternen, der noch dich nicht verstand,
Und dennoch, wenn auch irrend, dir geglüht,
Dem Jünglinge, der deine Gottheit nur
Im allverwüstenden Orkan gesucht,
Nicht zürntest du ihm, du vergabst ihm gern,
Du großes Herz! Als Alles mein noch war,
Da schien′s, als liebtest du mich weniger,
Und als ich Alles nun verlor, da warst
Es du, die Alles mir ersetzt. Als mich
Das Sterbliche verließ, da zeigtest du
Das Ew′ge mir; als ich verzagt war, gabst
Du Muth und Kraft mir in′s gesunkne Herz;
Als ich auf Erden nichts mehr fand, worauf
Vertrau′n, eröffnetest du mir die Welt,
Die nie betrügt; als mir die Gegenwart
Zur Nacht geworden, führte mir dein Geist
Das holde Mondlicht der Vergangenheit
In meines Lebens düstres Reich zurück,
Und wecktest, wenn auch nur im Silberduft
Der Mondnacht, einen neuen Frühling mir,
Und liehst der Nachtigall die Zaubermacht
Ihr Weh zu klagen in die Einsamkeit.
Und als auch die Vergangenheit zu eng
Mir ward, da lüftetest den Schleier du,
Den schicksalsvollen, der die Zukunft deckt,
Und zeigtest mir den weiten Ocean,
Den ungemeßnen, wo die kühne Schaar
Der Ruhmbegier′gen unter Klipp′ und Sturm
Auf unfruchtbarer Woge schwankend kämpft,
Und ließest mich im magisch fernen Duft
Das neue Eiland sehn, wo spät vielleicht
Nach langer Irrfahrt mich die Ruh′ empfängt.
O Muse, was verdank′ ich dir, was bin
Ich ohne dich? Ich denk′ es nicht, weil ich
Mich ohne Seele ja nicht denken kann.
Das All, was wär′ es ohne Gott - die Welt
Des Lichts beraubt? und das Lebendige
Der heil′gen Luft? - was ohne Mutterbrust
Der Säugling, und was ohne Frühling wohl
Das Veilchen, und das ungestillte Herz
Wohl ohne Hoffnung der Unsterblichkeit?
Du älteste der Genien, die du warst,
Noch eh′ die Welt war, die dem Schöpfer du
Die Elemente scheiden halfst, daß sie
Nach richt′ger Weis′, in schöner Harmonie
Sich flohn und liebten, daß die Welten selbst
In streng gemeßnem Gange wandelten,
Du Geist der Urwelt, dessen schaffend Wort
Im Reich des Seins beherrscht, was auch sich nur
Mit gleichem Maß gebildet, Ton und Wort
Und menschliche Gestalt - das all′ ist dein!
Ein sprachlos Kind war selbst die Weisheit einst,
Du öffnetest ihr Herz und Mund, du warst′s,
Die einst dem Sichtbaren die Zagende
Mit himmlischer Gewalt entriß, und kühn
Sie durch die Welt des Geistigen geführt,
Du gabst ihr Muth und Licht, und wenn sie oft
So hoch von allem Irdischen hinweg
Gestrauchelt, hohe Lehrerin, da nahmst
Die Schwankende begeisternd du hinein
In deinen Aetherwagen und im Schwung
Der Winde trugst du durch den Himmel sie.
Du lehrtest sie die Sprache, sie zum Glück
Der Menschheit auferziehend, und dein Hauch,
Der schöpferische, gab der Schülerin
Die ersten heiligen Gedanken ein.
Und sanft bescheiden, wie du bist, hast du
Der Undankbaren nicht gezürnt, als sie
Im Wechsel der Jahrtausende vergaß,
Was sie dir dankt, das sie im Uebermuth
Und eiteln Eigendünkel endlich ganz
Von ihrer hehren Schwester loß sich riß,
Kein Platon mehr, von eurer Lieb′ erfüllt,
Auf Einer Opferschal′ im Tempel auch
Die Flamme der Begeisterung erhielt,
Da hörtest dennoch du nicht auf, wenn auch
Geschmäht vom Wahnwitz jener Rasenden,
Zu segnen das entartete Geschlecht.
O wär′ ich deiner würdig, wär ich′s auch
Nur halb, langmüth′ge Göttin, der ich mich
Beschämt nur näh′re. Ja, gesteh′ ich′s dir,
Zuweilen, wenn von der Cäsare Burg
Aus Riesentrümmern über′s alte Rom
Mein Auge schaut, erscheinst du furchtbar mir,
Und nicht vermag ich′s, deiner Stirne Glanz,
Dein ewig ruhig Antlitz anzuschau′n,
So groß erscheinst du mir, so niedrig ich.
Und dennoch, Freundin, wenn dein milder Geist
Mit süßem Licht die weite Wölbung hin
Im Pantheon der Dämmrung sich vermählt,
Da scheinst mit ernstem stillen Tiefsinn du
Auch mich zu rufen, und getröstet tritt
Dein Jünger aus dem alten Götterhaus.
Hab′ ich ja deine Huld geprüft, wenn auch
Ein Undankbarer, fühl′ ich′s ja so lang
Im Innern mir, wie du besel′gen kannst,
Wie du mein Alles bist, und weiß ich′s ja
Nun erst so unaussprechlich, da mir nichts
Von so unendlich vielem übrig blieb,
Bin ich ja doch so reich durch dich, so fest,
So duldsam, standhaft in des Unglücks Nacht,
So sicher auch am Abgrund. O vergib,
Vergib dem Frevelnden, der Opfer nur
Zu viele hab′ ich dir gebracht, das Letzte selbst,
Was mein noch war, gelassen, ganz mich dir,
Von allen Banden frei, zum Dienst geweiht.
Schau nicht auf das, was hinter uns, ich kann
Sonst nicht bestehn, zu wenig ist′s, und nichts
Ganz deiner Würd′ges, was ich that; sei mir,
O Freundin, ach nicht Freundin noch, sei mir,
O Göttin, gnädig - Dank, Unsterbliche,
Dank bring′ ich dir nur mit Unsterblichem.