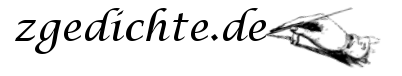Rötere Strahlen gießt die Sonne
Auf den leise flutenden Nil;
Hochauf mir zu Häupten flammt
Des Amenophis Koloß,
Fernher schon in der bleichen Wüste
Von den Karawanen erblickt,
Wenn von des innersten Meroë Palmenoasen
Sie nordwärts ziehen;
Im scheidenden Lichte glänzen
An des heiligen Stromes Ufern
Die Trümmer einer zerbrochenen Riesenwelt,
Hallen und Pfeiler, ins Unermess′ne gedehnt,
Gestürzte Titanenbilder,
Halb im wogenden Sande begraben.
Erstgeborne der Städte,
Hundertthoriges Theben!
Wie schwand das jubelnde Gedränge,
Das deine Säulenstraßen durchwogte,
Wenn, heimkehrend im Siegeszuge,
Sesostris bezwungene Völker,
Sei es vom eisigen Oxus,
Sei′s vom Lande der schwarzen Aethiopen,
Vor dem goldenen Sichelwagen dahintrieb?
Nie mehr haucht dein Memnon
Der nebelgebornen Aurora
Klangvoll entgegen den Morgengruß!
Deine Tempel, statt von lotosbekränzter Jungfraun
Festlichen Chören,
Nun von Schlangen der Wüste besucht!
Unwandelbar nur seit der Zeiten Beginn
Schaun Libyens Felsengebirge
Hinab auf die Trümmer von Reichen,
Die sie werden und fallen gesehn.
Wag′ ich den Gang
Durch die Reihen verwitterter Sphinxe,
Die, noch in die alte Traumnacht versunken,
Zu Seiten des Weges brüten?
Wie ins Unendliche zieht sich der Pfad
Vorbei an verschollener Königsgeschlechter
Palmenumrauschten Gräbern,
An Mauern und Säulengängen,
Wo jahrtausendelang
Schon flutendes Leben gewogt,
Bevor noch zu Kolchis′ Fabelstrande
Die Argonauten gesteuert.
Im bleichen Scheine des Mondes,
Der über Arabiens Hügeln steigt,
Himmelan ragt vor mir das Thor
Von Karnaks Tempelpalast.
Auf thun sich die Hallen,
Mauern auf Mauern wie Felsen getürmt,
Säulen, gleich blitzzerschmetterten Giganten
Häuptlings gestürzt, im Todeskrampf
Aneinander sich klammernd,
Spalten und Risse und Höhlen,
Als ob sie der Erdstoß in Felsen gesprengt!
Weiter nun, weiter,
Mit den gleitenden Schatten der Nacht
Von Halle zu Halle, von Saal zu Saal,
Wo an Wänden und Obelisken
In stummer Sprache Hieroglyphen
Von den Wundern der Vorzeit stammeln
Und Riesengestalten aus den Nischen
Wie vom Anfang der Zeiten herniederschaun!
Du dort im mystischen Dunkel
Zwischen steinernen Tafeln und Himmelskugeln,
Mächtige Göttin,
Die seit dem grauenden Morgen der Welt
Unter dem nie gelüfteten Schleier
Gedanken der Ewigkeit sinnt:
Löse die bangen Zweifel mir!
Ueber der Erde weiten Totenacker
Bin ich gewandert;
Vom Auf- zum Niedergang versank mir der Fuß
In der Asche zerstörten Lebens,
Wirbelte der Völker Staub
Unter meinem Tritt.
Werke von Uebermenschen
Fand ich wie Kinderspielwerk zerbrochen,
Reiche und Religionen
Bis auf den Namen verschollen.
Und ist in dem ew′gen Vergehn und Werden
Denn nirgend ein Halt?
All der Myriaden Menschen Geschick,
Die über die Erde geschritten,
Ist es, ein Irrlichttanz,
Im großen Dunkel erloschen,
Und taumelt Geschlecht auf Geschlecht
Der Vernichtung entgegen,
Daß ein Weltalter das andre betrauert,
Bis Vegessenheit alles verschlingt?
O in die öde Nacht des Gedankens
Laß einen Lichtstrahl gleiten,
Daß in der Verzweiflung finstern Abgrund
Nicht die zagende Seele versinke!
Stille ringsum, nur vom Knistern
Der zerbröckelnden Trümmer unterbrochen.
Schweigend hat die Göttin den Schleier
Um ihre Träume gebreitet;
Fort und fort brüten die Sphinxe
Ueber der Zeiten großes Rätsel;
Aber droben, wo aus der weiten Unendlichkeit
Mit leuchtenden Sternenaugen
Die Nacht herabsieht,
Ruht das Geheimnis
Ewig unenthüllt
Ueber allen Himmeln.